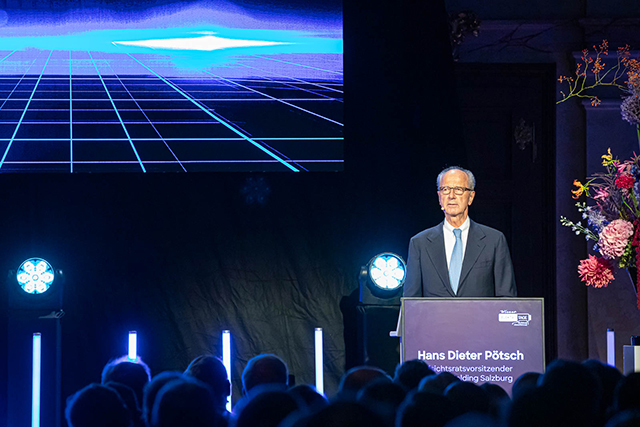Viele Führungskräfte wirken in stabilen Zeiten souverän. Sie moderieren Meetings, erreichen Zielvorgaben und präsentieren sich mit Selbstbewusstsein. Doch diese Fassade gerät ins Wanken, wenn die Rahmenbedingungen ins Rutschen kommen. In der Krise trennt sich die echte Führung von der gepflegten Illusion.
Die Welt verändert sich in atemberaubendem Tempo. Lieferketten reißen. Märkte verhalten sich unberechenbar. Gesellschaftliche Konflikte und politische Spannungen dringen tief in die Wirtschaft ein. Und genau in diesen Momenten offenbart sich die Qualität von Führung. Wer dann zaudert, verliert. Wer jedoch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn der Ausgang nicht sicher ist, wird zum Anker im Sturm.
„Wer Angst vor Fehlern hat, trifft keine Entscheidungen.“
Krisen stellen keine Ausnahme dar. Sie sind längst Teil des unternehmerischen Alltags. Das verlangt von Führungskräften mehr als operative Stärke. Es braucht innere Klarheit. Die Fähigkeit, auch unter Druck den Kurs zu halten. Den Mut, Entscheidungen zu treffen, die nicht allen gefallen, aber notwendig sind.
Den Überblick behalten
Führung in der Krise ist nicht die Stunde der Lauten. Es ist die Zeit der Klaren. Menschen, die sich selbst führen können, bevor sie andere führen. Menschen, die Konflikte nicht scheuen, sondern gestalten. Menschen, die zuhören können, ohne den Überblick zu verlieren.
In meiner Arbeit als Executive Interim Manager sehe ich Unternehmen von innen. Ich komme dann, wenn es brennt. Wenn Führung versagt hat oder nicht mehr greift. Und immer wieder zeigt sich: Es sind nicht fehlende Strukturen, die zum Problem werden. Es sind fehlende Haltungen. Führung wird oft mit Position verwechselt. Doch die beste Strategie nützt nichts, wenn sie nicht getragen wird. Wer führt, trägt Verantwortung. Und zwar nicht nur für das, was getan wird, sondern auch für das, was unterlassen wird. Das ist unbequem. Aber genau das macht Führung aus.
„Frauen, die in Verantwortung stehen, zeigen in schwierigen Momenten oft eine bemerkenswerte Klarheit.“
Besonders auffällig: Frauen, die in Verantwortung stehen, zeigen in solchen Momenten oft eine bemerkenswerte Klarheit. Sie führen integrativer, näher an den Menschen. Sie müssen sich nicht beweisen, sondern sie handeln. Sie sprechen weniger von Macht, aber zeigen mehr Wirkung. Das ist keine romantische Zuschreibung, sondern eine Beobachtung aus zahlreichen Projekten. Und ein Plädoyer dafür, mehr weibliche Führung in den Mittelpunkt zu stellen.
In Krisenzeiten zählt Substanz
Gute Führung beginnt nicht bei Prozessen, sondern bei der Person. Wer sich selbst nicht kennt, wird in der Krise zum Spielball. Wer seine Werte nicht reflektiert hat, weicht bei Gegenwind. Wer nur über Kontrolle führen kann, verliert in der Unsicherheit. Deshalb ist Selbstführung keine Privatangelegenheit, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor.
Frauen haben oft einen klareren Zugang zu dieser Form der Selbstführung. Vielleicht, weil sie seltener auf klassische Karrierewege vertrauen konnten und deshalb eigene Wege gehen mussten. Vielleicht, weil sie früh gelernt haben, mit Zweifeln und Zweiflern umzugehen, eigenen und fremden. Fakt ist: Frauen bringen in vielen Fällen mehr Substanz in die Führung ein. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie es können.
In Krisenzeiten zählt genau das: Substanz. Kein Theater, kein Zögern, kein Delegieren von Verantwortung. Unternehmen brauchen Führungskräfte, die bereit sind, sich in den Sturm zu stellen. Die zuhören, aber entscheiden. Die analysieren, aber auch handeln. Die nicht nach Anerkennung streben, sondern nach Wirkung.
Eine zentrale Herausforderung dabei: die Angst vor Fehlern. Viele Führungskräfte blockieren sich selbst, weil sie glauben, sie dürften sich keine Schwäche leisten. Doch genau diese Haltung lähmt. Wer Angst vor Fehlern hat, trifft keine Entscheidungen. Wer nicht entscheidet, verliert an Führung. Dabei ist der Fehler nicht das Problem. Das Problem ist, nichts daraus zu machen.
Fehler sind nicht das Ende von Führung, sondern oft ihr Anfang. Wer sie offen anspricht, schafft Vertrauen. Wer sie gemeinsam analysiert, fördert Lernen. Und wer sich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, zeigt Stärke. Frauen gehen mit Fehlern häufig reflektierter um. Sie suchen nicht nach Schuldigen, sondern nach Lösungen. Auch das ist ein Führungsstil, den wir heute dringend brauchen.
Vertrauen ist wichtig
Organisationen müssen deshalb mehr ermöglichen. Sie müssen eine Kultur fördern, in der Verantwortung nicht mit Status gleichgesetzt wird. In der jede und jeder Verantwortung übernehmen kann, unabhängig vom Titel. Denn Krisen lassen sich nicht allein von oben lösen. Sie brauchen Menschen auf allen Ebenen, die bereit sind, sich einzubringen.
Vertrauen ist dabei der Schlüssel. Es lässt sich nicht befehlen. Es muss gelebt werden. Wer Vertrauen schenkt, bekommt Verantwortung zurück. Wer Verantwortung ermöglicht, bekommt Engagement. Wer Engagement ernst nimmt, bekommt Loyalität. Und genau diese Loyalität trägt in der Krise.
Führung braucht echte Menschen
Unternehmen, die das verstanden haben, fördern eine neue Art von Führung. Sie investieren nicht nur in Technologie, sondern in Haltung. Sie messen Erfolg nicht nur an Zahlen, sondern an Stabilität. Und sie setzen nicht auf Führung als Dekoration, sondern als Entscheidung.
Was dabei oft vergessen wird: Führung ist kein Selbstzweck. Sie ist Mittel zum Zweck. Sie soll Orientierung geben, Zusammenhalt stiften und Zukunft gestalten. Dafür braucht es nicht mehr Kontrolle, sondern mehr Klarheit. Nicht mehr Druck, sondern mehr Dialog. Nicht mehr Statussymbole, sondern mehr Sinn.
In diesem Sinn: Führung in der Krise heißt, präsent zu sein. Nicht laut, aber deutlich. Nicht perfekt, aber mutig. Nicht angepasst, aber anschlussfähig. Es heißt, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn es unbequem ist. Es heißt, Haltung zu zeigen, auch wenn es Gegenwind gibt. Und es heißt, Mensch zu bleiben, gerade dann, wenn die Zahlen dominieren.
Frauen bringen dafür heute viele Stärken mit. Es wird Zeit, dass wir diese Stärken nicht nur anerkennen, sondern systematisch nutzen. Führung braucht jetzt keinen neuen Stil, sondern echte Menschen. Und sie braucht den Mut, vertraute Pfade zu verlassen. Denn wer in der Krise stehen bleibt, wird überholt. Wer aber klar bleibt, inspiriert andere, mitzugehen. Das ist Führung. Und sie beginnt genau jetzt.
Zum Autor
Hartwig Görtler ist ein international erfahrener Executive Interim Manager mit über 30 Jahren Berufserfahrung, spezialisiert auf Turnaround, Restrukturierung und Wachstum im Mittelstand. Seine Zeit als Offizier der Fallschirmjägertruppe und als Leistungssportler prägte seinen klaren, direkten Führungsstil: schnelles Erfassen, strategisches Handeln und kompromisslose Umsetzung. Als passionierter Jäger und Falkner setzt er sich aktiv für Artenvielfalt ein und wurde für sein Engagement mehrfach ausgezeichnet. BVMid Top Interim Manager 2024, Mitglied im Wirtschaftsbeirat Bayern und Experte im Club AMERITUM.
Foto: Shutterstock/Gorodenkoff