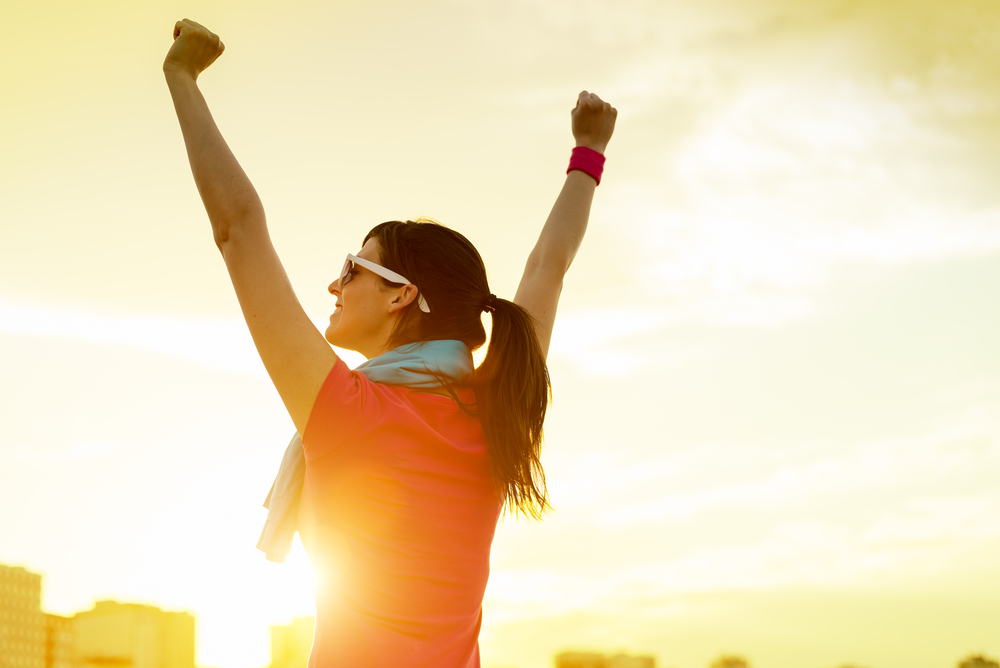Fast alle Menschen sind inzwischen regelmäßig im Internet unterwegs und nutzen es für die verschiedensten Dinge. In Zahlen sind dies knapp 90 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung, die täglich das Internet nutzen. Die anderen Länder in Europa haben ähnliche Zahlen aufzuweisen, was aussagt, dass die meisten Menschen in Europa das Internet täglich nutzen.
Dies zeigt bereits, wie stark die Digitalisierung vorangeschritten ist und wie sie immer mehr Teile des täglichen Lebens betrifft. Es gibt fast keinen Bereich mehr, der sich der Digitalisierung entziehen kann, so sind zum Beispiel die Casinos in den letzten Jahren enorm von der Digitalisierung beeinflusst und heute besteht ein enorm großes Angebot an Online Casinos wie Mr Green. Es sind jedoch vor allem die Medien, die stark von der Digitalisierung betroffen sind. Die Menschen schauen zum Beispiel ihre Serien und Filme im Internet oder bestellen Produkte des täglichen Bedarfs im Netz.
Aber auch in Unternehmen nimmt die Digitalisierung zu, was viele Vorteile mit sich bringt. Ein Vorteil davon ist, dass Büros und Unternehmen viel weniger Papier benötigen als dies noch vor 10 Jahren der Fall war, denn mittlerweile wurde Akten und Ordern digitalisiert und sind demnach nur noch digital zugänglich. Dies bringt außerdem den Vorteil mit sich, dass für die Akten, die früher noch in großen Schränken verstaut werden mussten, nun kein physischer Platz mehr benötigt wird.
Viele weitere Bereiche werden in Zukunft digitalisiert werden, denn die Digitalisierung vereinfacht vieles und eröffnet völlig neue Möglichkeiten. In diesem Artikel erfahren Sie deshalb, welche Beispiele es noch für die Digitalisierung gibt.
Musik ist digital
Der Musikmarkt ist enorm von der Digitalisierung betroffen, was anhand der großen Streamingdienste bewiesen werden kann, demnach nutzen zwischen 3 und 5 Millionen Musikhörer den digitalen Musikdienst im Monat. Vor ungefähr 30 Jahren nutzten die Menschen noch überwiegend CDs und Schallplatten, um sich ihre Musik anzuhören.
Dies hat sich nun enorm gewandelt, sodass auch die Charts nicht mehr an den verkauften platten gemessen werden können, sondern die Nutzerzahlen der verschiedenen Musikstreaming-Dienste für die Berechnung zurate gezogen werden.
Mit dem Fortschreiten der Digitalisierung im Bereich der Musik sind deswegen die Plattensammlungen und CD-Regale aus den Wohnzimmern verschwunden und wurden durch Smartphones, Tablets, PCs oder Internetradios ersetzt.
Diese Entwicklung hat der Musikindustrie erst schwer zugesetzt, aber nach und nach hat sich die Branche angepasst und auch die Angebote zum Musikhören digitalisiert. Das Problem dabei sind die verschiedenen Dienste, die dafür verantwortlich sind, dass die Musiker viel weniger Geld für ihre Werker erhalten als es zu Zeiten der CDs und Schallplatten noch der Fall war.
Filme und Serien
Genauso wie die Musik und die Literatur sind auch Filme und Serien von der Digitalisierung betroffen, was dafür sorgte, dass heute kaum noch jemand DVDs oder Blu-rays kauft, sondern stattdessen das Streaming nutzt. Die DVD, VHS und BluRay, die viele Menschen in Videotheken ausliehen, sind damit Geschichte, denn das Streaming hat gegenüber den physischen Medien viele Vorteile. Das Angebot der Streamingdienste ist enorm groß und kaum einer kann alles schauen, wozu er Zugang hat.
Dies sorgt dafür, dass es heute viel günstiger ist, sich Filme und Serien anzuschauen als noch vor 20 Jahren. Das Ausleihen von Filmen war früher relativ teuer, wohingegen rund 10 Euro im Monat bei den gängigen Streaming-Anbietern eine sehr niedrige Summe darstellt. Die Filmbranche musste sich ebenfalls zuerst umstellen, als die Streamingdienste aufkamen.
Doch die Filmemacher und Distributoren haben dies sehr gut hinbekommen, weswegen heute viele Serien in einer Art und Weise produziert werden, dass sie genau auf die Sehgewohnheiten der Nutzer passen. Die Anbieter von Streaming verzeichnen außerdem jeden Monat mehr Nutzer und profitieren direkt von der Digitalisierung dieser Branche.
Online Banking
Der Finanzsektor stellt einen weiteren Bereich dar, der auf eine sehr intensive Weise von der Digitalisierung betroffen ist, aber auch enorm davon profitierte. Heute geht kaum noch jemand zu einer echten Bankfiliale, wenn er eine Überweisung tätigen will, denn dies ist alles problemlos auf den Internetseiten der Banken möglich.
Wer Kunde bei einer Bank ist, der hat auch normalerweise einen Zugang zum Online Banking. Die Entwicklung geht sogar so weit, dass es mittlerweile viele Banken gibt, die ausschließlich im Netz agieren und keine feste Filiale mehr haben. Die länger bestehenden Banken haben dadurch bemerkt, dass sie nicht so viele Filialen benötigen wie sie haben und schlossen dementsprechend sehr viele Filialen vor Ort.
Auf diese Weise konnten die Banken Geld für Miete, Unterhaltskosten und Mitarbeiter sparen und dieses Geld in die Digitalisierung ihrer Dienste investieren. Im gleichen Sinne verhält es sich mit dem Aktienmarkt, der fast nur noch digital genutzt wird. Die Digitalisierung brachte den Banken und Finanzdienstleistern viele Vorteile, jedoch war auch in diesem Bereich eine Phase der Anpassung nötig.
Das moderne Büro ist digital
Nicht erst mit der Pandemie wurde klar, dass das Arbeiten von zu Hause aus die Zukunft ist. In dieser schwierigen Zeit mussten viele Menschen von zu Hause aus arbeiten und sich ein Home-Office einrichten. Da die Digitalisierung in der Arbeitswelt zu diesem Zeitpunkt bereits weit vorangeschritten war, was an den digitalen Akten zu sehen ist, war der Übergang jedoch nicht allzu schwer.
Die Angestellten müssen zum Arbeiten im Home-Office nur einen Rechner oder einen Laptop zu Hause haben und zusätzlich brauchen sie noch einen Zugang zu den Daten ihres Arbeitgebers. Dieser Zugang kann jedoch schnell eingerichtet werden, weswegen es für sehr viele Menschen normal wurde nur noch im Home-Office zu arbeite.
Zwar sinken die Zahlen derer gerade, aber in Zukunft dürften immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, weil die Unternehmen die Vorteile der Digitalisierung bemerkten. Sie können auf diese Weise viele Kosten sparen, die Mitarbeiter vor Ort täglich verursachen. Ebenso haben die Angestellten vom Home-Office ihre Vorteile, denn sie können sich den Weg zur Arbeit sparen und haben dadurch am Ende des Tages mehr Zeit.
Es gibt jedoch auch kritische Stimmen, denn viele arbeiten zu Hause mehr als im Büro, weil sie ständig an ihr Handy gehen und deswegen auch zu später Stunde oft noch arbeiten. Dieser Bereich der Digitalisierung wird sicher noch eine gewisse Zeit der Anpassung benötigen bis alles optimal abläuft. Diese Anpassungsphase ist jedoch bei allen Bereichen notwendig, die digitalisiert werden.
Foto: John Schnobrich
– Bereitgestellt von ImpulsQ –